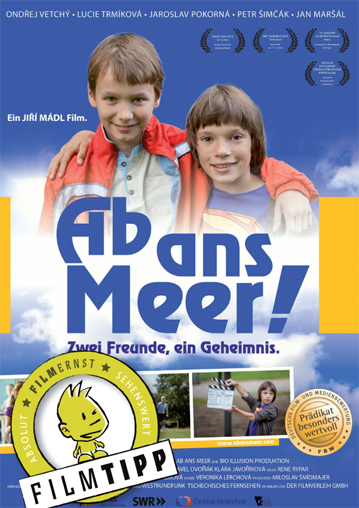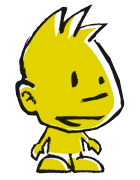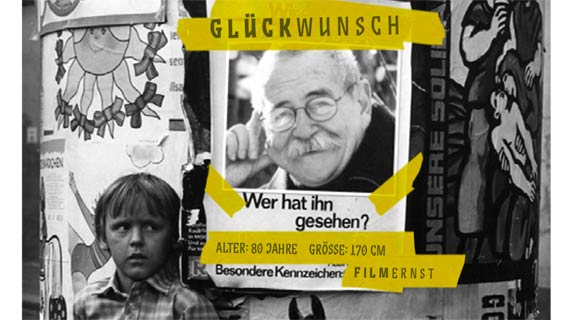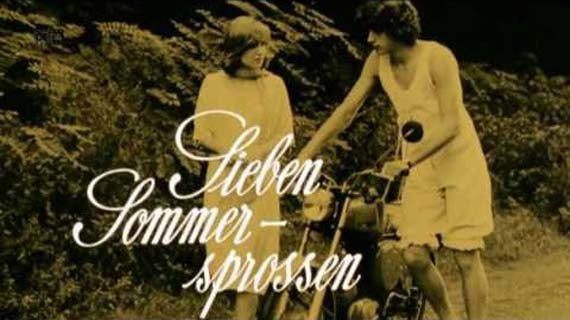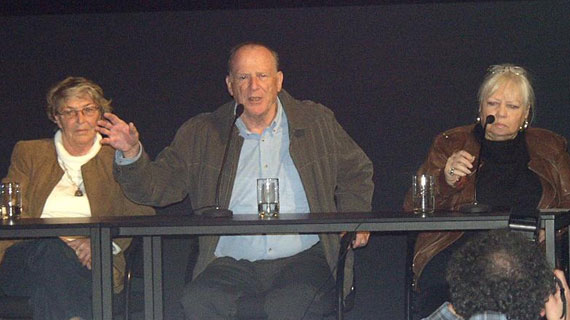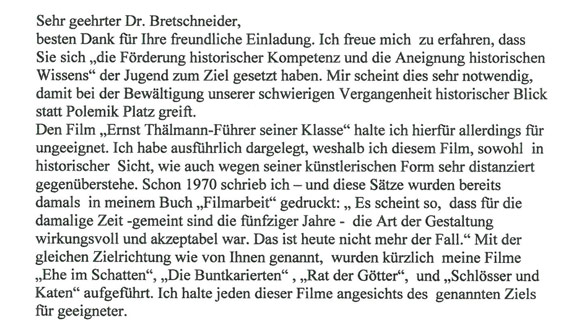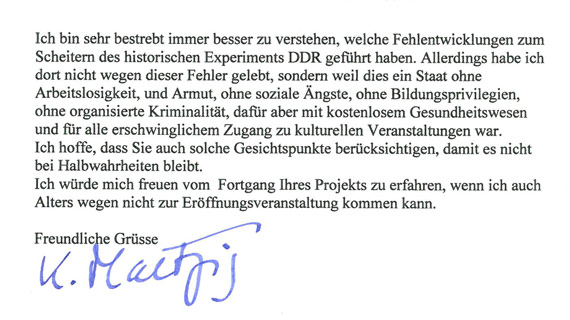»Pompöse Schulfunk-Ästhetik«. Wie mag die wohl aussehen, was führt sie im Schilde? Nichts Gutes, das ist klar! »Ein Diavortrag«, das klingt nicht ganz so nach Unterricht, aber ziemlich abwertend. »Womit Schulklassen in Zukunft gelangweilt werden«, formuliert es direkt und als Gewissheit. Allerdings ist es nur die Vermutung eines Filmkritikers, wie Schüler auf »Das Tagebuch der Anne Frank« reagieren. Wir hätten da vielleicht ein paar ganz konkrete Antworten, aus eigenem Erleben und direkter filmernster Erfahrung.
Die erste FILMERNST-Veranstaltung mit Hans Steinbichlers Anne-Frank-Film gab’s bereits Mitte März im Prenzlauer UNION, mit rund 200 Schülern von der »Philipp-Hackert«-Oberschule. Von Langeweile war da nichts zu spüren. Eher von Bewegung im Saal, Anteilnahme und Mitgefühl. Was die Schüler bewegt, mit- und nachfühlen lässt, was sie zu sagen haben zum Film und zur Figur, das werden wir in den weiteren, schon gebuchten Veranstaltungen noch genauer erkunden und erfahren. Ein Diavortrag jedenfalls, der kommt ganz anders daher.
»Das Tagebuch der Anne Frank« läuft bei uns im Rahmen eines Sonderprogramms, zu dem drei weitere Filme gehören. Beim Nachdenken über Anne Frank und den Film kam uns die Idee, ihr gewissermaßen drei Gefährtinnen an die Seite zu stellen: Junge Frauen, deren Leben und deren Geschichten – authentisch oder fiktiv – ebenfalls in jene Zeit zurückführen, die uns menschlich eindrucksvoll und künstlerisch ausdrucksvoll berühren und bewegen.
Die vier Filme, neben »Das Tagebuch der Anne Frank« noch »Sophie Scholl – Die letzten Tage« sowie »Lore« und der DEFA-Klassiker »Die Schauspielerin« mit der jungen Corinna Harfouch in der Titelrolle, sind »Wunschfilme«, also ohne feste Termine und Spielorte.
Wenn Sie Interesse daran haben, dann rufen Sie uns bitte an oder schicken uns eine Mail.
Wir freuen uns über jede Anfrage und jede Anmeldung – die Krönung ist natürlich, wenn eine Klasse oder Gruppe im Rahmen eines Projekts gleich alle vier Filme sehen will. Sie glauben, das gibt’s nicht? Doch, an der »Immanuel Kant«-Gesamtschule in Falkensee!
Und um noch mal auf die »Schulfunk-Ästhetik« zurückzukommen: Es gibt auch Kritiker, die sehen es anders – und zwar so: »Entstanden ist ein engagierter, hochsensibler, geradezu zärtlicher Film über ein aufgewecktes junges Mädchen – mit dem brutalstmöglichen Ende, das einem die Tränen in die Augen schiessen.« (Hermann Thieken, programmkino.de)